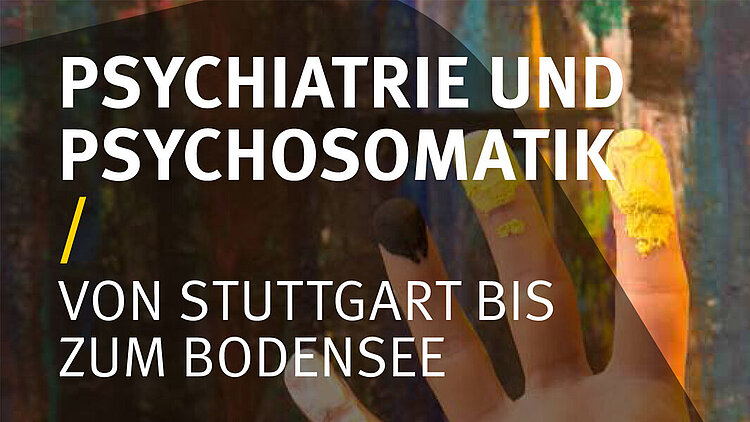Unter dem Titel „Digitale Transformation in der Psychiatrie – Möglichkeiten und Grenzen“ fand am Welttag für Seelische Gesundheit die 35. Psychiatrische Ethiktagung des ZfP Südwürttemberg und der PP.rt Reutlingen statt. Rund 200 Fachleute kamen in Reutlingen zusammen, um über den Einfluss neuer Technologien auf Therapie, Beziehungsgestaltung und Berufsidentität in der psychiatrischen Versorgung zu diskutieren.
„Psychiatrische Versorgung bemüht sich um Menschen – sie steht immer mitten im Leben und muss zugleich in einer zunehmend digitalen Welt eine ethisch reflektierte Handlungsweise finden“, eröffnete Prof. Dr. Gerhard Längle, Geschäftsführer der PP.rt und Regionaldirektor im ZfP Südwürttemberg, die Tagung. Er betonte die Herausforderungen, die mit der zunehmenden Digitalisierung einhergehen: „Digitale Hilfsmittel wie Robotik, künstliche Intelligenz und Online-Therapieformate bieten Chancen, dürfen aber die zwischenmenschliche Beziehung nicht ersetzen. Wir müssen kritisch prüfen, wo ihr Einsatz sinnvoll ist - aber auch wo mögliche Risiken liegen.“ Die diesjährige Tagung widme sich der Frage, inwieweit diese Technologien verantwortungsvoll in der psychiatrischen Versorgung eingesetzt werden können. „Unser Ziel ist es, neue Möglichkeiten zu evaluieren und Transparenz über den Einsatz digitaler Hilfen zu schaffen“, so Längle weiter. Im Verlauf des Tages beleuchteten Expertinnen und Experten die Chancen, aber auch die Grenzen digitaler Entwicklungen – von ethischen Fragen über Datenschutz bis hin zur möglichen Entfremdung im therapeutischen Prozess.
Zwischen Fortschritt und Verantwortung
Einen eindrucksvollen Einstieg boten Dr. Hubertus Friederich und Ralf Aßfalg mit der Vorstellung des empathischen Kommunikationsroboters „Navel“. In einem kurzen Video wurde den Anwesenden demonstriert, wie maschinelles Verhalten Empathie simulieren kann – und wo emotionale Authentizität ihre Grenzen findet. Mit seiner Fähigkeit, Gespräche zu führen, Emotionen zu erkennen und zur Aktivierung anzuregen, biete „Navel“ potenziell eine Unterstützung für Pflegekräfte, so Aßfalg. Der Pflegerische Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik Alb-Neckar betonte jedoch: „Es ist kein Pflegeroboter – die zwischenmenschliche Beziehung bleibt unverzichtbar.“ Ein sechsmonatiger Testeinsatz auf zwei gerontopsychiatrischen Stationen am ZfP-Standort Zwiefalten soll noch in diesem Jahr beginnen.
Dass der Einsatz solcher Technologien stets die Wahrung der menschlichen Würde und die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen in der Pflege im Blick behalten müsse, führte Friederich im Folgenden aus. „Wir wollen heute auch über die Limitierungen und die ethischen Fragestellungen sprechen“, so der Ärztliche Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik Alb-Neckar. Er stellte die „Prinzipien der Biomedizinischen Ethik“ vor – ein praxisnaher Ansatz, um komplexe ethische Fragen in Medizin und Psychotherapie zu klären. Das Modell beruht auf vier zentralen Prinzipien: Respekt vor Autonomie, Fürsorge/Wohltun, Nichtschaden und Gerechtigkeit. Diese böten Fachkräften einen klaren Orientierungsrahmen, um konkrete Situationen zu beurteilen, moralische Entscheidungen abzuwägen und ethisch verantwortungsvoll zu handeln, denn: „Letztlich ist jeder Einsatz einer künstlichen Intelligenz im Einzelfall zu prüfen.“
Forschung mit Praxisbezug
Julia Kämmer von der Katholischen Stiftungshochschule München stellte das interdisziplinäre Forschungsprojekt „SMiLE2getherGaPa“ vor. Ziel des Projekts ist es, durch einen Co-Design-Prozess gemeinsam mit Pflegefachkräften praxisnahe Einsatzmöglichkeiten für robotische Assistenzsysteme im Pflegealltag zu entwickeln. Speziell sei dabei auf die Bedürfnisse von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen eingegangen worden, so Kämmer. Konkrete Einsatzgebiete für Assistenzrobotik sollen in den nächsten Schritten definiert werden.
Aktuelle Erkenntnisse zur Evidenz digitaler Behandlungsformen stellte die Psychotherapeutin Leonie Bauer vor. So haben Digitale Gesundheitsanwendungen (sogenannte DIGAs) mittlerweile Eingang in die S3-Leitlinien gefunden: „Diese Apps punkten durch geringe Zugangshürden, eine gute Alltagstauglichkeit sowie flexible Möglichkeiten der Therapiegestaltung.“ Ihr Einsatz bringe jedoch auch Herausforderungen mit sich, etwa mangelnde Wirksamkeitsprüfungen, unklare Haftungsfragen und eine nur begrenzte Eignung für bestimmte Störungsbilder. „Insgesamt bieten DIGAs eine potenziell wertvolle Ergänzung in der psychiatrischen Versorgung“, fasste die Therapeutin zusammen. Der Einsatz erfordere jedoch stets eine kritische Reflexion, insbesondere hinsichtlich des Datenschutzes.
Echte Empathie bleibt menschlich
Dr. Frank Schwärzler, Ärztlicher Leiter der PP.rt Reutlingen, zeigte in seinem Vortrag, dass Empathie das Herz jeder therapeutischen Beziehung ist – und dass echte Empathie nicht programmierbar ist. Künstliche Intelligenz kann lediglich „empathisches Verhalten“ simulieren, indem sie sprachliche Muster erkennt und darauf reagiert. Sie kann die Arbeit von Fachkräften unterstützen, aber menschliche Begegnung nicht ersetzen. Gerade angesichts des drohenden Fachkräftemangels in Psychiatrie und Psychotherapie sei es verlockend, auf KI zu setzen – zugleich warnte Schwärzler vor Risiken: „Server-Standorte in China oder den USA können Datenschutzprobleme mit sich bringen und der Nutzen von KI-Lösungen darf nicht über ihre möglichen Gefahren gestellt werden.“ Sein Fazit: Digitale Technologien bieten viel Potenzial, müssen aber stets kritisch und verantwortungsvoll eingesetzt werden.
Dieter Haug, Leiter des Zentralbereichs Verwaltung und Zentrale Dienste, und IT-Leiterin Angelika Gasser gaben Einblicke in den Einsatz interner KI-Systeme zur Wissensorganisation im ZfP Südwürttemberg. Ziel sei es, den Transformationsprozess durch digitale Anwendungen zu beschleunigen und das vorhandene Wissen effizient nutzbar zu machen. So soll ein KI-gestützter Chatbot künftig auf abgelegte Datensätze zugreifen können. Da das System lokal betrieben wird, seien die Datenschutzrisiken minimal und rechtliche Anforderungen würden gewahrt. „Voraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz eines solchen Chat-Bots sind strukturiertes Datenmaterial, umfangreiche IT- und Datenschutzkonzepte, ein kompetenter IT-Support sowie eine offene Unternehmenskultur“, so Haug.
Ethik als Kompass im digitalen Wandel
Am Nachmittag setzten die Teilnehmenden ihre Diskussionen in verschiedenen Workshops fort. Im Mittelpunkt standen dabei die Stärken und Schwächen digital unterstützter Therapieformate, die Wahrung menschlicher Nähe bei robotischer Pflegeunterstützung, reale Erfahrungen im Umgang mit „Navel“ sowie die Frage, ob Automatisierung in sozialen Organisationen Arbeitsplätze gefährdet oder die Versorgungssicherheit verbessert. Die offene und kollegiale Atmosphäre ermöglichte einen intensiven Austausch über persönliche Erfahrungen und ethische Fragestellungen, die sich aus der zunehmenden Digitalisierung des psychiatrischen Alltags ergeben.
„Gerade in der Psychiatrie müssen wir genau hinsehen, wo Technik echte Hilfe leistet – und wo sie das Miteinander verändert“, fasste PP.rt-Pflegedirektor Uwe Armbruster, der die Tagung moderierte, den Tenor des Tages zusammen. Zum Abschluss betonten die Veranstalter, dass die Digitalisierung nicht nur technische, sondern vor allem ethische Entscheidungen erfordere. „Es geht nicht um Fortschritt um jeden Preis, sondern um eine verantwortungsvolle Integration neuer Möglichkeiten in eine humane Psychiatrie“, so Prof. Dr. Gerhard Längle in seinem Schlusswort.