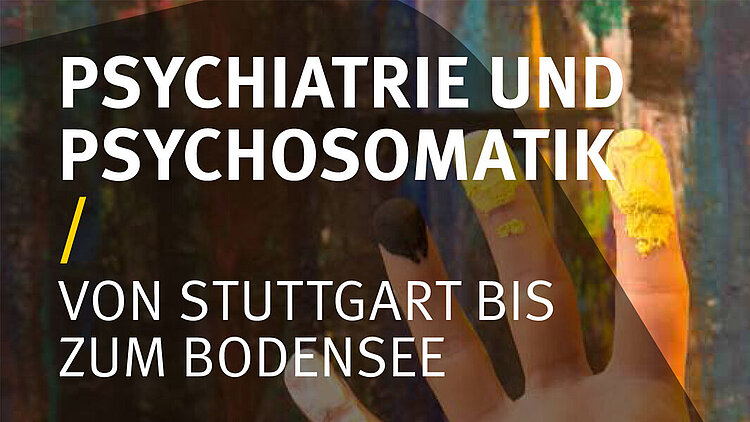Hin zu einer besseren psychiatrischen Versorgung, die Bedürfnisorientierung und Teilhabe ermöglicht – die stationäre psychiatrische Versorgung in Deutschland muss sich weiterentwickeln. Dieses Ziel und dessen Durchsetzungsmöglichkeiten diskutierten die Teilnehmenden des Symposiums „Enthospitalisierung 2.0“, zu dem das ZfP Südwürttemberg nach Weissenau geladen hatte.
Wie können Bedürfnisorientierung und gesellschaftliche Teilhabe für schwer psychisch kranke Menschen besser umgesetzt werden? Welche finanziellen, strukturellen und gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen werden hierfür benötigt? Darüber diskutierten die Teilnehmenden des Symposiums „Enthospitalisierung 2.0“ im Hörsaal des Klosters Weissenau. „Wie geht die Ambulantisierung nicht nur lokal, sondern auch national weiter“, fragte Prof. Dr. Iris Tatjana Graef-Calliess, Zentralbereichsleiterin Forschung und Lehre im ZfP und Mitorganisatorin. Und auch Martin Holzke, Zentralbereichsleiter Pflege und Medizin, freute sich, dass sich so viele Menschen dem Thema widmen möchten. Anwesend waren zahlreiche ZfP-Mitarbeitende, Vertreter von Krankenkassen und anderen Kliniken sowie von Interessensverbänden.
Transformation als Antwort
Zunehmende Nachfrage, begrenzte Kapazitäten, demografischer Wandel und weitere Herausforderungen wie Fachkräftemangel und Kostensteigerungen beschäftigen das psychiatrische Versorgungssystem und zwingen zum Umdenken, wie ZfP-Geschäftsführer Dr. Dieter Grupp in seiner Einführungsrede darstellte: „Wir wollen ein ambulanteres Versorgungssystem.“ Auf die Frage, wie das gelingen könne, müsse die Antwort „Transformation“ lauten. „Transformation ist unsere Kernkompetenz“, sagte Grupp, und verwies auf bisherige Erfolge: Ambulante Strukturen konnten aufgebaut werden, während der stationäre Anteil mit seinem hohen Personalaufwand verringert werden konnte. Die stationsäquivalente Behandlung (StäB) werde an allen Standorten des ZfP angeboten, darüber hinaus wurden Tagesklinikplätze ausgebaut. „Wir machen uns weiter auf den Weg hin zu einer besseren Versorgung.“
Einen Paradigmenwechsel forderten auch Ilona Herter, Pflegedirektorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Region Donau-Riss und Dr. Hubertus Friederich, Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik Alb-Neckar. „Betroffene sind der Ausgangspunkt unseres Tuns und nicht die Zielgruppe“, sagte Herter. „Wir wollen in Zukunft noch flexibler, kreativer und vernetzter denken.“ Transformation sei ein Thema für alle, eine Frage der Haltung und zur Zukunft.
Politischer Wille und Mut sind gefragt
„Grenzen überschreiten im Kopf und in der Lebenswelt“ lautete der Zusatztitel zu dem Symposium, worauf zwei Referenten des Tages besonders eingingen: Zuerst Prof. Dr. Arno Deister, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin. Er erläuterte am Beispiel der psychiatrischen Klinik in Itzehoe, wie mithilfe des Regionalbudgets eine hohe Ambulantisierung gelingen konnte. Im Rahmen eines Modellprojekts, das seit 23 Jahren dort durchgeführt wird, konnte die Bettenanzahl um 60 Prozent reduziert werden. Die Klinik habe keine ersichtlichen Stationen, keine Ambulanz, sondern alles in einem Gebäude. Was zählt, sei die therapeutische Beziehung. „Eine Halbierung der stationären Verweildauer bei unveränderten Patientenzahlen, eine hohe ambulante Rate sowie mehr Tagesklinikplätze – und das alles bei gleich gebliebene Kosten“, beschrieb Deister das Erfolgsbeispiel. „Wir brauchen den politischen Willen und Kostenträger, die verstehen, dass innovative Konzepte Kostensteigerungen reduzieren können“, mahnte er. Zudem ermutigte er die Anwesenden: „Wir brauchen Menschen, die verändern wollen.“
Prof. Dr. Sebastian von Peter, Oberarzt der Hochschulklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Rüdersdorf, ging auf eine gelingende Versorgung mit einem globalen Behandlungs- und Teilhabebudget ein. In der Versorgungsforschung gebe es erfolgreiche Vorläuferprojekte in Schleswig-Holstein, die als Modellprojekte seit einigen Jahren gut liefen. „Der politische Wille war da, die ambulante und Zuhausebehandlung stieg an“, legte von Peter dar. Er erläuterte verschiedene Budget-Modelle und wies darauf hin, dass Planungssicherheit ein Anreiz sei für Kostenträger und Leistungserbringer. Es brauche insgesamt eine breite Beteiligungsstruktur und den Aufbau von lokal bereits vorhandenen und gewachsenen Strukturen.
Wie eine Versorgung ohne geschlossene Stationen und seit sieben Jahren mit einem Regionalbudget gelingen kann, erläuterte Dr. Jose-Marie Koussemou. Der Chefarzt der Psychiatrischen Klinik in Heidenheim zeigte sich überzeugt vom Prinzip der Offenen Türen in seiner Klinik: Deeskalation durch Beziehungsarbeit, keine Isolationen, 1:1-Betreuung und eine enge Kooperation mit Polizei, Ordnungsamt und Niedergelassenen sowie mit ambulanten Diensten sei der Schlüssel. Die Vernetzung gehe in alle Seiten, auch zu Angehörigen und Betreuern sowie den Gemeindepsychiatrischen Verbünden. Die Klinik bietet Zuhausebehandlung („Hometreatment“) nach Bedarf an, da dies ressourcenschonender als StäB sei. Virtuelle Tagesklinikplätze sind auf der Station mit eingeplant. Seit diesem Modellprojekt gebe es weniger Gewalt gegen Mitarbeitende oder Mitpatient:innen, die Zahl der Fixierungen sei geringer als im Durchschnitt. Als Vision stellte Koussemou vor, dass in den kommenden Jahren der Großteil der Menschen in ambulanten und aufsuchenden Settings versorgt werden könnte.
Mehr Teilhabe für Erkrankte
Im Interesse der behandelten psychisch kranken Menschen sprach Rainer Schaff. Der selbst Psychiatrieerfahrene und Gründer von EX-IN Bodensee sah es als essentiell an, dass Betroffene und ihre Angehörigen in Umgestaltungsprozesse gut miteinbezogen werden. Insgesamt lobte Schaff den guten patientenorientierten Ansatz im ZfP Südwürttemberg mit Genesungsbegleitenden. Diese seien Mutmacher und ermöglichten Beteiligung der Patient:innen. Er regte einen trialogischen Prozess zusammen mit den Angehörigen und ihren Vertretungen im Sinne der Betroffenen an. „Es geht nicht nur um die Verlagerung der Behandlung hin zum Wohnort, sondern vor allem darum, soziale Teilhabe zu ermöglichen und Räume hierfür für die Betroffenen zu schaffen.“ Psychisch Erkrankte seien immer noch Stigmatisierung und Ausgrenzung ausgesetzt.
Am Nachmittag vertieften die Teilnehmenden des Symposiums in Kleingruppen verschiedene Themen in Workshops. Zum Beispiel beschäftigte sich eine Gruppe mit Partizipation aus Betroffenensicht, Lebensweltbezug statt Klinikfokus oder Personalgewinnung, Mitarbeitenden-Motivation und Haltung sowie weiteren. In einer gemeinsamen Podiumsdiskussion berieten die Workshop-Teilnehmenden und Geschäftsführungsmitglieder von ZfP Südwürttemberg und ZfP Reichenau die weiteren Herausforderungen in der sich verändernden psychiatrischen Versorgung. Claudia Vallentin, Ärztliche Direktorin am Standort Waldshut des ZfP Reichenau, nahm als Anregung mit: „Nicht erst abwarten, bis es andere Finanzierungswege gibt, sondern auch einmal unkonventionelle Wege finden.“ Die Motivation der Beschäftigten und der Akteure sei jedoch wichtig. „Die Mitarbeitenden sind bereit für Veränderung und haben Lust darauf“, so Tanja Waidmann, Leiterin Ambulante Dienste und Teilhabe in der Region Donau-Riss im ZfP Südwürttemberg. Teilhabe werde jedoch oft dann nicht möglich, wenn die Finanzierung nicht ausreiche, merkte Interessenvertreter Rainer Schaff an.
Geschäftsführung ist bereit
Der designierte Geschäftsführer des ZfP Südwürttemberg, Dr. Paul Lahode, bedankte sich bei allen Beteiligten für die Motivation und das Interesse. „Wir haben einen guten Grundbaustein für eine gute Transformation.“ Der Mensch stehe im Mittelpunkt, dies sei weiterhin die zentrale Unternehmenshaltung. „Unser Job ist es, eine gute Versorgung für die Menschen zu bieten. Den Patient:innen ist es letztlich egal, woher das Geld dafür kommt“, machte Lahode klar. Der neue Geschäftsführer stehe hinter der Idee der Transformation. „Sich ausprobieren, Fehler machen, daraus lernen und umsetzen“, ermutigte er. Lahode zeigte sich ebenso beeindruckt von BEREIT!: Den Meilenstein für die Weiterentwicklung der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung hat seit Juni der Auftakt des Transformationsprojekts „BEREIT!“ von ZfP Südwürttemberg, ZfP Reichenau und der PP.rt Reutlingen gesetzt. In den kommenden Jahren wird dabei gemeinsam bedürfnisorientiert eine rechtskreisübergreifende Versorgung entwickelt. Die Umsetzung von Veränderungsprojekten in der Versorgung liegt hierbei in der Verantwortung der Regionen, um die spezifischen Bedürfnisse und Gegebenheiten vor Ort zu berücksichtigen. Martin Holzke, Zentralbereichsleiter und einer der Projektleiter, versprach beim Symposium, dass es innerhalb des ZfP Beteiligungsformate für Mitarbeitende geben werde.