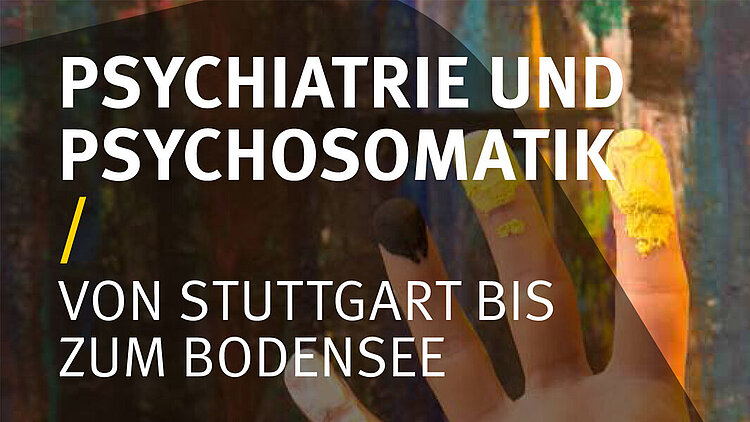Neue Behandlungsformen für schwer behandelbare Epilepsieformen, Möglichkeiten des EEGs und Demenzdiagnostik bei Intelligenzminderung und Epilepsie – zu diesen und weiteren Themen informierten Expert:innen der Epilepsie-Akademie Weissenau des ZfP Südwürttemberg.
Zum bereits 15. Mal informierten Expert:innen verschiedener Berufsgruppen über Aktuelles zur Diagnostik und Therapie von schwer behandelbaren Epilepsieformen. Erstmalig fand die traditionelle Veranstaltung nicht wie bisher im Ravensburger Schwörsaal, sondern auf dem Klinikgelände des ZfP in Weissenau statt. „Mit der Veranstaltung hier vor Ort möchten wir das Bewusstsein für die Behandlungsmöglichkeiten in unserem Hause schärfen“, erklärte PD Dr. Christian Tilz, Leiter der Klinik für Neurologie und Epileptologie. An ihn und sein Team richtete Dr. Andreas Honikel-Günther, Erster Bürgermeister der Stadt Ravensburg, lobende Dankesworte. Das ZfP mit seiner Expertise sei ein unverzichtbarer Teil der Stadt. „Veranstaltungen wie diese tragen dazu bei, die komplexe Krankheit Epilepsie greifbarer zu machen und ihr den Schrecken zu nehmen.“
Dass es Hoffnung und Fortschritte in der Forschung für Menschen mit schwer behandelbarer Epilepsieformen gibt, verdeutlichte Tilz mit Verweis auf neue anfallssupprimierende Medikamente. Als Prototyp einer neuen Art von Medikamenten für einzelne Epilepsiesyndrome beschrieb er das Medikament Fenfluramin, das bei seltenen Epilepsieformen wie dem Dravet- Syndrom eingesetzt werde. Doch einem Drittel aller Epilepsieerkrankten helfe medikamentöse Therapie nicht ausreichend. „Operative Verfahren bieten die Chance, die Ursache der Erkrankung zu beseitigen.“ Als dritte Möglichkeit, schwere Epilepsien zu behandeln, stellte der Chefarzt drei Verfahren der Neurostimulation vor: Von der altbewährten Vagus-Nerv-Stimulation (VNS) über die Tiefe Hirnstimulation bis hin zur neuen Epikraniellen Stimulation (EASEE). „Es werden gezielt Therapiemöglichkeiten mit guter Verträglichkeit und Wirksamkeit entwickelt“, machte Tilz Betroffenen Mut. Warum ein erster epileptischer Anfall nicht bedeuten muss, an Epilepsie erkrankt zu sein, führte er anschließend aus. Fünf Prozent der Menschen erleiden in ihrem Leben einen Anfall. „Wichtig ist dann, den Anfall und die Umstände, die zu diesem führten, diagnostisch abzuklären.“ Insbesondere im höheren Alter steige die Fehldiagnose Epilepsie, da Symptome wie Bewusstseins- oder Sprachstörungen verkannt oder fehlinterpretiert werden. „Eine umfassende Differentialdiagnose ist zwingend notwendig. Denn die richtige Diagnostik entscheidet über den Therapieerfolg.“
Eine entscheidende Rolle bei der Diagnostik nehme die Elektroenzephalografie (EEG) ein, wie Anja Lau, Mitarbeiterin des EEG-Labors, verdeutlichte. Die Medizinisch-technische Assistentin zeigte Vor- und Nachteile verschiedener EEGs auf. Während ein nur zwanzigminütiges Routine-EEG meist zur Basisdiagnostik und Therapiekontrolle herangezogen werde, diene ein mobiles Langzeit-EEG auch zur Differentialdiagnostik. Dabei werden Hirnströme der Patient:innen mehrere Tage elektrisch abgeleitet und aufgezeichnet. „Beim Video-EEG-Monitoring werden zusätzlich Anfallssituationen auf Video aufgenommen, woraus wir wertvolle Rückschlüsse auf die Art der Anfälle ziehen können.“ Eins zu eins werden dabei Video und EEG übertragen. Da bestimmte Anfälle nur mit der Videoanalyse klassifiziert werden können, betonte Lau abschließend, sei dieses Verfahren so wichtig.
Neue Perspektiven für Betroffene
Die Diagnose Epilepsie stellt viele Betroffene vor neue Herausforderungen: „Wie gehe ich mit meinen Ängsten um? Wie bewältige ich meinen neuen Alltag, Beruf und meine Freizeitaktivitäten? Darf ich noch Auto fahren?“ Dass es bei der Erkrankung nicht nur um medizinische Fragen geht, sondern auch die sozialpädagogische Beratung eine ganz zentrale Rolle spielt, erläuterte Sozialarbeiterin Heike Bierenstiel in ihrem Beitrag „In geschütztem Rahmen erarbeiten wir gemeinsam mit den Betroffenen Lösungsansätze und neue Perspektiven.“
Dem Thema Demenzdiagnostik bei Menschen mit Intelligenzminderung und Epilepsie und damit einhergehenden Herausforderungen widmete sich Mirijam Geiger-Riess, die als Psychologische Psychotherapeutin im ZfP tätig ist. Die Betroffenen, insbesondere jene mit Trisomie 21, haben ein fünffach höheres Risiko an Demenz zu erkranken. „Symptome wie Lethargie und sozialer Rückzug treten bei ihnen noch vor Desorientiertheit und Gedächtnisstörungen auf“, so die Neuropsychologin über den abweichenden Krankheitsverlauf. Da verschiedene Faktoren die Frühdiagnostik erschweren, rät sie, den Entwicklungsverlauf engmaschig zu beobachten und einmal jährlich ein Screening mit Fragebogen durchzuführen. „Es bedarf einer Verlaufsuntersuchung für den intraindividuellen Vergleich.“ Ziel sei, so die Referentin, Lebensqualität und Teilhabe möglichst lange zu erhalten und den Betroffenen eine frühzeitige Behandlung zu ermöglichen.
Die regen Nachfragen der Anwesenden im vollbesetzten Saal der Alten Schwimmhalle zeigten, dass großes Interesse an aktuellen Forschungsergebnissen, Behandlungsmethoden und Tipps rund um das Krankheitsbild besteht. Auch im nächsten Jahr ist wieder ein Vortragsabend für Fachleute, Angehörige sowie Betroffene geplant.