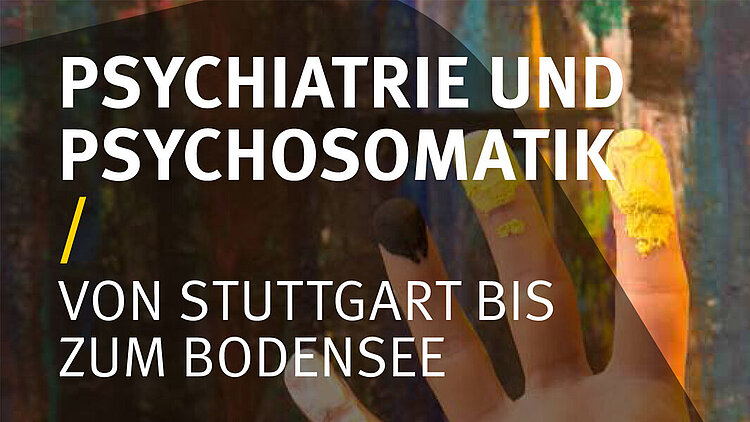Wie können Kinder psychisch und suchterkrankter Eltern darin unterstützt werden, sich trotz hoher psychischer Belastung gesund zu entwickeln? Zu dieser Frage tauschten sich die Teilnehmenden des vom ZfP Südwürttemberg und Amts für Kinder, Jugendliche und Familien des Landratsamts Ravensburg organisierten Fachtags aus.
Jedes vierte Kind in Deutschland wächst mit einem psychisch und oder suchterkrankten Elternteil auf. Insgesamt vier Millionen Kinder sind gefährdet, sich dadurch nicht altersgemäß entwickeln zu können: Ihre physiologischen, aber auch emotionalen Bedürfnisse werden unter Umständen nicht adäquat wahrgenommen, sie erleben zum Teil keine sichere Bindungsperson und sind in ihrer Alltagsgestaltung eingeschränkt.
„Es handelt sich um kein Randphänomen“, betonte Sozialarbeiterin Sabine Rief, die im ZfP Südwürttemberg als systemische Therapeutin und Projektleiterin tätig ist. Gemeinsam mit Karena Schulenburg vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des Landratsamts Ravensburg begrüßte sie die Teilnehmenden. Dass großer Bedarf an Weiterbildung zum Thema besteht, verdeutlichte der vollbesetzte Klostersaal: Neben Sozialarbeiter:innen und Mitarbeitenden von Beratungsstellen und der Jugendhilfe waren auch zahlreiche pädagogische Fachkräfte ins ZfP Südwürttemberg nach Weissenau gekommen. „Es gibt nicht nur eine große Anzahl an betroffenen Kindern, sondern auch viel Unwissen zu psychischen Erkrankungen und Ratlosigkeit im Umgang mit den betroffenen Familien“, verdeutlichte Schulenburg. Sie ermutigte aber dennoch: „Wir alle können etwas tun.“ Mitarbeitende unterschiedlicher Institutionen zu stärken und ihnen Informationen und Unterstützungsangebote an die Hand zu geben, sei das Ziel des Fachtags.
Schützende Faktoren nehmen Einfluss
Welche wichtige Rolle Beratungsstellen für betroffene Familien spielen und wie bedeutsam die Zusammenarbeit einzelner Hilfesysteme ist, verdeutlichten Daniela Colleoni, Leiterin der Psychologischen Familien- und Lebensberatung der Caritas Ravensburg, und Jeanette Boetius, Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle der Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee. „Eine psychische Erkrankung der Eltern kann eine Kindeswohlgefährdung bedeuten, muss es aber nicht“, betonte Colleoni. Individuelle Rahmenbedingungen können beeinflussen, wie sehr sich die Erkrankung eines Elternteils auswirkt: Wie schwer ist die psychische Erkrankung und wie umfangreich wird die Familie versorgt? Gibt es Unterstützung aus dem Umfeld? Verschiedene schützende Faktoren wiederum tragen dazu bei, dass Kinder psychisch stabil und gesund bleiben: Zu den stabilsten Schutzfaktoren zählen Krankheitswissen, ein offener Umgang mit der Krankheit innerhalb der Familie und stabile Bezugspersonen.
Vernetzung aller Hilfesysteme
Beide Leiterinnen betonten die Wichtigkeit von Kooperation als Intervention. Auch hier bestehe Verbesserungsbedarf. Noch immer seien Hilfesysteme schlecht vernetzt und haben wenig Kenntnis voneinander. „Es gilt, Hilfesysteme auch auf institutioneller Ebene zu vernetzen“, forderte Boetius. „Die beste Unterstützung erhalten Familien, wenn verschiedene Hilfesysteme miteinander arbeiten.“ Die Leiterin erinnerte außerdem an die Zuständigkeit jedes Einzelnen: „Jeder Person, der es gelingt, eine tragfähige Beziehung zum Kind und gegebenenfalls den Eltern aufzubauen, ist zuständig.“
Anhand verschiedener Praxisbeispiele aus ihrer Beratungstätigkeit zeigten Colleoni und Boetius auf, wie sie mit betroffenen Eltern ins Gespräch gehen und welche Methoden angewandt werden. „Im Mittelpunkt steht das Verhalten der Erkrankten, nicht die Diagnose“, erinnerte Colleoni und riet dazu, alle Seiten zu beleuchten: „Defizite, Stärken, Ressourcen – all das darf und soll ausgewogen zur Sprache kommen.“ Zur gelingenden Gesprächsführung tragen Empathie und Wertschätzung sowie ein sensibler Umgang mit der Scham der Eltern bei. Dennoch sollte trotz eines positiven Beziehungsaufbaus das Wohl der Kinder im Blick behalten werden. „Wenn eine Gefährdung ungeachtet unserer Intervention nicht abzuwenden ist, müssen wir aktiv werden und die Gefährdung melden.“ Nicht zwingend gehe damit ein Beziehungsabbruch einher, betonten die Referentinnen.
Die regen Nachfragen der Anwesenden zeigten, dass großes Interesse an Handlungsempfehlungen und Tipps aus der Praxis besteht. Die Teilnehmenden nutzten die Möglichkeit, Anregungen und Impulse in ihren pädagogischen Arbeitsalltag mitzunehmen. In den anschließenden Workshops zu Themen wie beispielsweise „Betroffene im Gespräch – Eltern“, „Baumstark – für dich und für andere“ oder „Resilienzförderung bei Kindern“, tauschten sich die Teilnehmenden noch intensiver untereinander und mit Expert:innen aus.