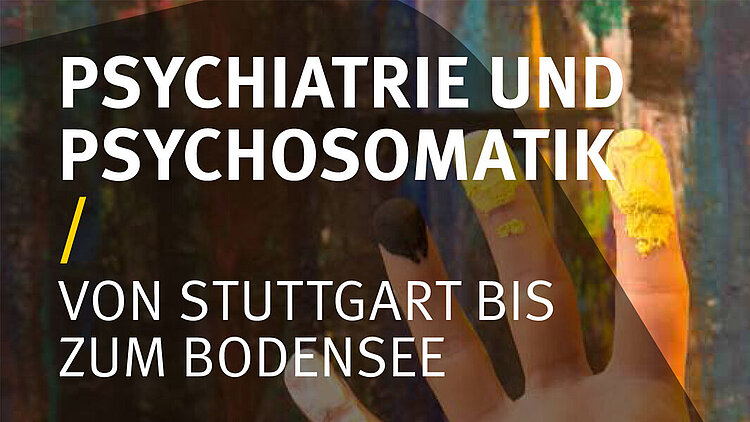Im Rahmen der 34. Jahrestagung der Klinik für Kinder und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie (KJPP) des ZfP Südwürttemberg diskutierten rund 320 Fachleute aktuelle Forschungsansätze und Behandlungsstrategien in der Versorgung von Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten und Persönlichkeitsstörungen.
Anlass für dieses Tagungsthema war laut Chefärztin Dr. Sabine Müller die Situation, dass trotz zunehmenden Wissens über Persönlichkeitsstörungen im jungen Alter, S3-Leitlinien zur Borderline-Persönlichkeitsstörung und wirksamer Behandlungsmöglichkeiten es unter Fachleuten immer noch Kontroversen darüber gebe, ob eine frühzeitige Diagnose einer Persönlichkeitsstörung unethisch, zulässig oder hilfreich sei. Durch frühe Diagnosestellung und somit frühe, störungsspezifische Behandlung könne viel Leid vermieden und eine positive Entwicklung unterstützt werden.
Nach der Begrüßung durch den pflegerisch-pädagogischen Klinikleiter Frank Happich sprach Prof. Dr. Jörg Fegert zum Auftakt. Der Ärztliche Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm ordnete die aktuelle Diskussion um eine mögliche Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters in den Kontext entwicklungspsychologischer Erkenntnisse ein. Er plädierte für frühe Hilfen statt strafrechtlicher Verschärfungen: „Zwischen elf und 14 Jahren ist die Impulsivität hoch und die Abschreckung durch Strafen gering, weshalb präventive und therapeutische Unterstützung sinnvoller sind als Bestrafung.“ Er verwies zudem auf gesellschaftliche Risikofaktoren wie digitale Gewalt und Cannabis-Konsum, die gerade bei psychisch belasteten Jugendlichen eine große Rolle spielten. Ein Blick in die Schweiz zeige, dass dortige Modelle mit therapeutischer Unterbringung deutlich bessere Ergebnisse erzielen als Haftstrafen. Fegert: „Jugendliche entwickeln sich stabiler, bleiben häufiger in Ausbildung und erleiden seltener Rückfälle.“
Prof. Dr. Charlotte Rosenbach, Psychologische Psychotherapeutin an der HMU Health and Medical University Erfurt, stellte anschließend ein Interventionsprogramm für Mütter mit Borderline-Störung vor, das Stabilität und sichere Bindung in den ersten Lebensjahren ihrer Kinder fördert. Kinder von erkrankten Müttern hätten ein erhöhtes Risiko, selbst eine Persönlichkeitsstörung zu entwickeln, so Rosenbach, gezielte Unterstützung könne hier präventiv wirken. Diplom-Psychologin Andrea Dixius präsentierte im Anschluss die dialektisch-behaviorale Therapie für Adoleszente (DBT-A). Die leitende Psychologin am SHG-Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie Saarbrücken führte aus, dass Achtsamkeit, Emotionsregulation und validierende Kommunikation entscheidende Bestandteile einer erfolgreichen Behandlung sind, die das Identitätsgefühl und den Selbstwert der Jugendlichen stärken.
„Bis zu 9 Prozent der Jugendlichen haben eine Störung des Sozialverhaltens. Sie sind begehen jedoch circa die Hälfte der Straftaten in ihrer Altersgruppe“, warf Prof. Dr. Svenja Taubner provozierend in den Raum. Die Direktorin des Instituts für psychosoziale Prävention an der Universität Heidelberg erläuterte in ihrem Vortrag den mentalisierungsbasierten Therapieansatz für externalisierende Störungen. Entscheidend sei es, nicht nur ein bestimmtes Verhalten, sondern die dahinterliegenden inneren Zustände zu verstehen. Wer lerne, sich und andere zu verstehen, könne auch sein Verhalten verändern. „Bestrafung allein bewirkt meist das Gegenteil“, betonte Taubner und teilte damit den Ansatz, den Fegert zu Beginn einbrachte.
Dr. Marc Birkhölzer erläuterte die Neukonzeptualisierung von Persönlichkeitsstörungen in den Diagnosesystemen DSM-5 und ICD-11. Dabei betonte er, dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung derzeit überwiegend als Entwicklungsstörung mit Beginn in der Adoleszenz eingeordnet werde, mit einem Beginn im Alter von zirka 13 Jahren. Ansätze, die Störung erst im Erwachsenenalter zu diagnostizieren, seien überholt. Im Weiteren stellte er das Adolescent Identity Treatment (AIT) vor, einen tiefenpsychologisch verankerten Ansatz zur Förderung der Identitätsentwicklung. Frühzeitige Diagnostik und die Einbeziehung des sozialen Umfelds seien entscheidend, da dieses einen hohen Einfluss auf den Therapieerfolg habe. „Verschiedene Perspektiven ergeben das Gesamtbild der Persönlichkeitsstörung. Nur wenn wir verstehen, was Jugendliche fühlen, können wir die Symptomatik richtig einordnen“, so der Oberarzt der Jugendforensischen Ambulanz der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel.
Das Bild einer weiteren Persönlichkeitsstörung zeichnete Prof. Dr. Marc Allroggen, der sich dem pathologischen Narzissmus widmete. Aggression und Narzissmus seien eng miteinander verbunden, was die Wahrscheinlichkeit für aggressives Verhalten bei narzisstisch geprägten Persönlichkeiten deutlich erhöhe, so der Leitende Oberarzt an der Ulmer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da Betroffene selten Einsicht zeigen, gelinge Behandlung oft nur über klare Strukturen und langfristige therapeutische Beziehung.
Über diese längerfristigen Beziehungen sprachen zum Abschluss auch Theresa Schockenhoff, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Therapeutische Stationsleiterin, und Anna Bozek-Magin, als Jugend- und Heimerzieherin und Pflegekoordinatorin im Pflege- und Erziehungsdienst dieser Jugendstation tätig. Die beiden Fachfrauen stellten das strukturierte Therapieprogramm „choose to change“ (CTC) vor. Dabei handelt es sich um ein Behandlungsprogramm für Jugendliche, bei denen Schwierigkeiten in der Emotionsregulation mit dysfunktionalen Problemlösungsstrategien wie etwa selbstschädigendes Verhalten im Vordergrund stehen. Eine Intervallstruktur soll Regression entgegenwirken und gleichzeitig zur Etablierung neuer funktionaler Verhaltensmuster im Lebensalltag beitragen. „Das CTC war der perfekte Start für mich, um meine Krankheit richtig kennenzulernen“, zitierte Magin eine Patientin, die sie im vergangenen Jahr erfolgreich durch das Programm geführt hatte. Das Modell zeige, wie nachhaltige Veränderung durch eigenverantwortliches Handeln entstehen könne.
Zum Abschuss der brillanten und vom Publikum mit langem Applaus honorierten Fachvorträge dankte Chefärztin Müller allen Mitwirkenden für den intensiven Austausch: „Wir sollten uns immer wieder fragen, ob das, was wir tun, wirklich wirkt. Heute haben wir viele inspirierende Antworten darauf gehört.“ Im nächsten Jahr wird der Akutbereich der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie am ZfP-Standort Weissenau einen Neubau beziehen, was voraussichtlich im Mai 2026 mit einem Tag der offenen Tür der gesamten Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie Weissenau begangen werden wird. Demzufolge wird es erst in 2027 die nächste klassische Jahrestagung der KJPP geben.